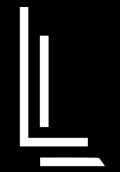04 | Der Kleine Prinz
Der kleine Prinz
Erinnern Sie sich an den 1998 produzierten Spielfilm »Die Truman Show« mit Jim Carrey in der Hauptrolle? In ihm fällt dem Versicherungsvertreter Truman Burbank auf der Straße seiner Heimatstadt Seahaven versehentlich ein Scheinwerfer direkt vor die Füße, der bis dahin einen Stern am simulierten Himmel dargestellt hatte. So kommt Burbank erst in seinem 29-igsten Lebensjahr dahinter, dass er unwissentlich die Hauptrolle in einer 24-stündigen Fernsehunterhaltungsshow spielte.Oder vielleicht kennen Sie den Film »Matrix« aus dem Jahr 1999 mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Den Programmierer Thomas Anderson beschleicht seit einiger Zeit das Gefühl, dass mit der Welt irgendetwas nicht stimmt. Auf der Straße sieht er eine Szene zweimal, wie bei einer Bildstörung im Kino, ein Deja vu. Dennoch ist dies sein reales Leben. Schließlich kommt Anderson dahinter, dass sein gesamtes bewusstes Leben und das aller anderen Teil eines hochkomplexen Computerprogramms sind, das die virtuellen Menschen kontrolliert, während die realen Menschen als Nahrungs- und Energiereserven dahinvegetieren.
Und dann haben Sie bestimmt schon einmal »Der kleine Lord« in der Verfilmung von 1980 nach einer Romanvorlage aus dem Jahr 1886 gesehen. Cedric Errol lebt als liebenswerter, kleiner Junge in sehr bescheidenden Verhältnissen in New York, als er erfährt, dass er ein kleiner englischer Lord ist. Er zieht nach England, um sein Erbe anzutreten, und rührt dort das kaltherzige, aristokratische Herz seines Großvaters.
Wer kennt nicht den Traum vom reichen, unbekannten Onkel in Amerika, nach dessen Tod man unerwartet vermögend wird. Hatten Sie schon einmal solche Gedanken? Ich schon! Den kleinen Wassermann trieben solche Wünsche in zahllose Tagträumereien hinein. War ich wirklich der Sohn meiner Eltern? Kam ich überhaupt von diesem Planeten? Die vielen Comics, die ich zu dieser Zeit las, haben mich wahrscheinlich in diesen Gedanken beflügelt.
Da war »Superman«, eigentlich Kal-EL, der von seinem Vater, Jor-EL, wegen des nahenden Untergangs seines Heimatplaneten Krypton mit einer Rakete nach Kansas geschossen worden war.
Da war der »Silver Surfer«, Norrin Radd, vom Planeten Zenn-La. Er rettete seine Welt und seine große Liebe Shalla Bal, indem er sich dem Weltenzerstörer Galactus als Herold anbot, der daraufhin Zenn-La verschonte. Fortan musste der Silver Surfer im Universum nach neuen Planeten suchen, von denen sich Galactus ernähren konnte. Zu seiner Geliebten konnte Radd niemals wieder zurückkehren und zog fortan einsam und allein auf einem surfbrett-ähnlichen Fortbewegungsmittel durch das All.
Eines verband meine Comichelden. Alle hatten eine Tragik in sich, die sie suchen, kämpfen und nicht ruhen ließ. Ist es im normalen Leben nicht auch so?
Mein Lieblingsheld wurde »Spider-Man«, alias Peter Parker, ein schüchterner und unbeliebter Schüler, der von einer radioaktiven Spinne gebissen wurde und daraufhin Superkräfte entwickelte. Weil er den Tod seines Onkels nicht verhindern konnte, treiben ihn Schuldgefühle. Peter Parker wird zum klassischen, tragischen Helden, der das Gesetz schützt, aber dennoch von der Öffentlichkeit mit Argwohn betrachtet und oft selbst für kriminell gehalten wird. Na, welches Kind findet sich hier nicht wieder? Der kleine Wassermann tat es.
Natürlich suchte ich auch nach eigenen Geschichten à la »Der kleine Lord«. Ich war überzeugt, ich sei also ein Prinz. Meine königlichen Eltern hätten mich zu Erziehungszwecken abgegeben. Ich sollte nicht in herrschaftlichen Verhältnissen aufwachsen, um nicht zu abgehoben und eingebildet zu werden. Ich sollte das normale Leben kennenlernen, damit ich sowohl Verständnis für Land und Leute als auch Milde erlernte. Sobald ich älter wäre, würden sich alle offenbaren und das Schauspiel beenden. Dann könnte ich meine Rolle als Prinz einnehmen, um einmal König zu werden. Über das Land, das ich einst regieren sollte, machte ich mir keine Gedanken. Dieser Ansatz hielt nicht lange. Der kleine Wassermann älter wurde, aber kein König, keine Königin, nicht einmal ein Herold kam. Das Herz des kleinen Wassermanns wurde schwer.
Meine Fantasiemaschine ratterte weiter. Auch die »Truman Show« erwies sich als nicht stichhaltig. Weder fiel mir ein Scheinwerfer vor die Füße, noch fand ich Beweise, dass mein gesamtes Leben nur eine Unterhaltungsshow ist. Die Theorie ließ sich nicht halten. Sollte mein Leben eine große Inszenierung sein, so musste ich mich damit abfinden, sie nicht aufdecken zu können.
Meine Gedankenmaschine unternahm noch einen letzten Versuch. Ich war nicht von dieser Welt. Nun wusste ich es. Das erklärte, warum ich mich oft unwohl und fremd, nicht gesehen und gehört fühlte, warum ich immer wieder auf den Meeresgrund hinabtauchte. Ich verstand nicht, weshalb Menschen sich stritten, fies und gemein waren, anderen wehtaten. Wieso hatte ich immer so viele Fragen im Kopf? Wieso war ich aber still und fragte niemanden, wieso versank ich immer wieder in mich?
Die Lösung war einfach: Meine Eltern waren nicht meine Eltern. Ich war ein Fremdling, ein Außerirdischer. Doch wie kam ich hierher? Ich spann mir eine galaktische Erkundungsmission meines Volkes auf diesem rückständigen Planeten namens Erde zusammen, infolge derer ich schlichtweg vergessen worden war. Ich musste nur warten, bis sie kamen, um mich abzuholen. Aber niemand kam.
Ich suchte nach einem Grund: Ich war nicht vergessen, sondern vielmehr absichtlich ausgesetzt worden. Dieser Erklärungsansatz wurde wahrscheinlich aus Selbstmitleid geboren, aber erlöste mich davon, weiter zu warten. Meine Fantasie ging weiter mit mir durch. Meine eigentlichen, außerirdischen Eltern hätten mich aus Fürsorge, ähnlich wie Superman, auf der Erde ausgesetzt. Die Sache war geritzt, aber nur für einige Kinderjahre. Irgendwann war es nicht mehr zu leugnen: Ich war kein kleiner Lord, kein Prinz und kein ausgesetzter Außerirdischer. Es gab einfach keinerlei Hinweise oder gar Beweise hierfür.
Wenn ich heute zurückblicke, denke ich, dass Kinder Produkte ihrer Eltern sind. Sie übernehmen elterliche Verhaltensmuster oder lehnen sie ab. Meine Fantastereien dienten einfach dazu, einen Raum in der Familie zu finden, der noch nicht von anderen Familienmitgliedern besetzt war und in dem ich atmen konnte. Was konnte ich als Kind über meiner Familie sagen? Mein Vater war für mich eine richtige Autorität. Er war streng und milde. Preußische Tugend hörte ich ihn das nennen. Ich hatte Respekt vor ihm, manchmal auch Angst. Vor allem blieb mein Hunger nach Liebe, Aufmerksamkeit und Bestätigung oft ungestillt. Meine Eltern arbeiteten sehr viel, vor allem mein Vater. Meine Schwester war ein paar Jahre älter und konnte damals nicht viel mit mir anfangen. Wir stritten und waren Herz und Seele. So wie Geschwister nun einmal sind. Meine Großmutter mütterlicherseits war ein herzensguter Mensch. Doch oft erschien sie mir merkwürdig abwesend. Mit der Großmutter väterlicherseits konnte ich nicht viel anfangen. So war ich häufig für mich.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten waren meine Noten in der Schule befriedigend bis gut geworden. Die Legasthenie wurde mir nach einem erneuten Test wieder aberkannt. Zum Glück war ich einigermaßen sportlich. Sonst wäre ich womöglich schnell in die Ecke des Strebers geraten. Zaghaft interessierte sich auch mal ein Mädchen in der Schule für mich. Was heißt interessieren? »Was sich neckt, das liebt sich!» Erinnern Sie sich noch? Ich wurde auf dem Schulhof von Mädchen geknufft, oder meine Schulsachen wurden versteckt. Was ist es, dass Menschen Interesse füreinander entwickeln lässt? Mein Aussehen konnte es nicht gewesen sein. Ich fand mich hässlich.