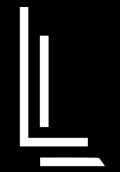08 | Berliner
Der Berliner
»Was willst du denn mal werden, wenn du groß bist, Junge?«
Darauf wusste der Wassermann keine Antwort ¬ und die wichtigtuerischen Gesichter der Erwachsenen hingen ihm gründlich zum Halse raus.
»Ich werde Anwalt!«, antwortete ich mit 14 Jahren trotzig. Die Erwachsenen waren beruhigt.
Aus welcher Schublade der Meeresgrundbewohner das herausgekramt hatte? Ganz einfach. Ich hatte meinen Vater öfter davon reden gehört, dass er gern studiert hätte und Anwalt geworden wäre. So übernahm ich einfach seine Sehnsucht, vielleicht auch, um den Erwartungen der Erwachsenenwelt gerecht zu werden.
Dann hatte ich die Reifeprüfung ich in der Tasche und die erste große Liebe überlebt. Meine Interessen und das Profil der Rechtswissenschaften deckten sich nach Auskunft der netten Dame der Berufsberatung, die in unsere Schule gekommen war. Mir war mulmig, als ich den Brief mit meinen Bewerbungsunterlagen an die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen in Dortmund vor unserer städtischen Postniederlassung in den Briefkasten einsteckte. Ich hatte ihn extra durch die halbe Stadt gefahren und dort eingeworfen, wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass er verloren geht oder durch einen Briefkastenanschlag an einer Straße im Nirgendwo vernichtet wird, sank. War dies die richtige Studienwahl? Reichte mein Numerus clausus aus? In welche Stadt werde ich kommen? Werde ich das Studium schaffen? Wen werde ich kennenlernen? Diese und tausend andere Fragen malträtierten mein Hirn. Mein Verlangen, von zu Hause auszuziehen, war groß, das flaue Gefühl im Magen ebenso. Unter dem Punkt »Ortsantrag« hatte ich in den Bewerbungsunterlagen an erster Stelle West-Berlin eingetragen, dahinter Hannover und Göttingen.
In der elften Klasse hatte ich eine Studienfahrt nach West-Berlin gemacht. Der Exfreund meiner Schwester, Patrick, studierte dort bereits an der Technischen Universität, als ich ihn besuchte. Eine westdeutsche Stadt, ummauert vom ostdeutschen Ausland. Berlin soll angeblich mehr Brücken als Venedig haben. Für West-Berliner waren wir anderen »Dörfler« oder »Wessis«. Das hatte ich während meiner Kurzaufenthalte bereits verstanden. Die Verachtung stieg mit der Anzahl der Buchstaben des Autokennzeichens. Bei uns zu Hause hatten wir drei.
Trubel, multikulturelles Leben. Ich mochte diese verrückte, einzigartige, halbe Stadt, die nicht schlief, von Anfang an. Ich malte mir eine Zukunft als erfolgreicher, lässiger Anwalt in einem supermodernen Appartement über den Dächern Berlins aus und hatte keine Ahnung, was mich wirklich erwartete. Zunächst folgten Wochen des bangen Wartens.
»War der Postbote heute schon da, Mama?«
»Nein, wie oft willst du mich das noch fragen?«
Endlich kam die Bestätigung eines Studienplatzes an der Freien Universität in West-Berlin. Nun brauchte ich dringend eine Wohnung. Doch wie fand man vor der Zeit der globalisierten Kommunikationswelt ein Nest in West-Berlin? Ich rief Patrick an. Er sagte mir, was zu tun war. Über 300 Kilometer Straße waren es laut Patrick vom Haus meiner Eltern nach West-Berlin. In die ummauerte Stadt konnte man nur über drei Autobahnen, nicht viel mehr Bahntrassen und mit wenigen Flugzeuglinien gelangen. Mit weichen Knien stieg ich in einen knallroten Kadett-C, Baujahr 1973, mein erstes eigenes Auto. Auf dem Beifahrersitz lag eine Straßenkarte, auf der ich den Weg akribisch markiert hatte. Von unseren Nachbarn hatte meine Familie eine schaurige Geschichte gehört. Bei Nacht waren sie im Nebel von der Transitstrecke abgekommen, von der Volkspolizei aufgegriffen und unter Spionageverdacht zwei Wochen eingesperrt worden. Meine Eltern winkten hinter mir her. Ich sah sie noch im Rückspiegel, als ich um die Ecke bog. Oh, weh, Bautzen, hoffentlich komme ich nicht!
Gegen sechs Uhr abends traf ich nach einer Weltreise und zwei Grenzkontrollen mit Grummeln im Bauch am Bahnhof Zoologischer Garten ein. Auf dem Meeresgrund kannte sich der Wassermann einigermaßen aus, aber das hier war etwas anderes, eine komplett andere Welt. Ich hatte mich durch die finster dreinblickenden Grenzpolizisten mit sächsischem Akzent während der einstündigen Wartezeit in der Schlange am Grenzübergang Marienborn bei Helmstedt mächtig einschüchtern lassen. Nein, natürlich hatte ich nichts zu verzollen und auch sonst niemanden an Bord. Den Sinn der Fragen verstand ich nicht. Es folgten endlose 160 Kilometer über die holprigen Betonplatten der Transitstrecke bei vorgeschriebenem Höchsttempo von 100. Am Grenzübergang Dreilinden erging es mir nicht anders. Nach dem Passieren beider Grenzübergänge stand es schwarz auf gelb. Ich war da. Berlin.
Patrick hatte mich gut eingewiesen. Über die Avus und den Kurfürstendamm kam ich wider Erwarten problemlos am Zoo an. Dort wartete ich nervös im Bahnhof mit vielen Gleichgesinnten brav auf die Auslieferung der Berliner Morgenpost für den folgenden Sonntag. Darin sollte es die meisten Anzeigen für den West-Berliner Wohnungsmarkt geben. Kaum hatte ich ein Exemplar ergattert, traf auch schon Patrick ein. Ich war so erleichtert, ihn zu sehen. Am Abend studierten wir in einer Pizzeria mit Selbstbedienung in der Turmstraße das Angebot und zogen am Sonntag in die Schlacht. Zum Glück fuhr er mich mit seinem Auto. Selbst vor den letzten, heruntergekommenen Absteigen trafen wir auf eine Traube von Menschen. Hierbei ergab sich sehr schnell eine besondere Art Relativitätstheorie: je billiger und abgewrackter die Bude, desto größer die Traube. Ich füllte mehrere Bewerbungsbögen aus und fuhr völlig frustriert Sonntagabend wieder aufs platte Land. Wer sollte schon einem Studenten ohne festes Einkommen eine Bude geben? Wieso sollte es ausgerechnet mir als einer von vielen Trauben an der Weinrebe der Zuschlag gegeben werden? Am Dienstagabend rief ein Makler bei meinen Eltern an und erlöste mich. Ich hatte einen Sechser im Lotto gewonnen. Ich konnte mich beim Anruf des Maklers noch sehr genau an die Wohnung im Arbeiterviertel Wedding erinnern. Nach der Besichtigung in der Kameruner Straße hatte ich gegenüber Patrick gewitzelt, ob sich der Vormieter wohl selbst aus dem Leben befördert hatte. Die Wohnung lag im dritten Stock eines Altberliner Mehrfamilienmietshauses und bestand aus einem Zimmer mit Loggia, Küche und Bad. Mein Vorgänger hatte – wahrscheinlich als Folge zu vieler Haschkekse – an den Wänden traumatisierende Farben in Orange, Dunkelblau, Fiesgrün, und Schwarz hinterlassen. Aber egal, ich hatte eine Wohnung!
Nach der Erledigung des Papierkrams per Post und Bank, Kaution und Provision hörte ich in diesem Zusammenhang das erste Mal, mietete mein Vater zwei Wochen später einen kleinen Lastwagen. Am Samstagabend wurde nach seinem Ladenschluss eingeladen, und schon ging es los. Fast hätten mein Vater und ich mit dem Kleintransporter Marienborn nicht passieren dürfen. Uns fehlten irgendwelche Zollformulare, von denen ich noch nie gehört hatte. Ich wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass man Mobiliar, das sich an der Grenze zum Sperrmüll befand, verzollen musste. Nachdem sich der ostdeutsche Grenzpolizist von unserer wertvollen Fracht überzeugt und Protokolle ausgeführt hatte – und vielleicht auch aufgrund der mitternächtlichen Zeit –, ließ er uns endlich passieren. Ich ließ ein Stoßgebet los.
Wir kamen nachts mit dem Umzugswagen vor meiner neuen Wohnstätte an. Mein Vater stieg aus und trat sogleich voll in Hundefäkalien hinein. In Berlin gab es viele Hunde, und das Gerücht kursierte noch aus der Zeit der Berliner Luftbrücke, dass die Vierbeiner als Notration dienen sollten. Die Gehsteige meiner Straße waren nahezu komplett vollgeschissen. Es war eine Kunst, nicht hineinzutreten. Manche Fußgänger gingen lieber auf der Kopfsteinpflasterstraße. Berlin soll die Hauptstadt der Hunde mit über 100.000 vierbeinigen Einwohnern gewesen sein, die jährlich 55.000 Tonnen Scheiße in der Öffentlichkeit hinterlassen, das sind ca. 146 Millionen Tretminen. Scheiße am Hacken war für meinen Vater eine harte Prüfung. Die Fäkalien entsorgte er gekonnt an der Bordsteinkante und betrachtete danach verwundert die graue, abgeblätterte, mit Farbschmierereien überzogene Hausfassade. Einige forderten die Deutschen auf, das Land zu verlassen, andere aus der braunen Ecke die Ausländer, Deutschland zu verlassen. Die meisten konnte ich überhaupt nicht entziffern. Die Eingangstür zum Haus stand offen, das Schloss war kaputt. Das Klingelbrett ließ meinen Vater den Kopf schütteln. Es war verschmolzen. Später erfuhr ich, dass Haarspray und ein Feuerzeug Wunder wirken können. Während wir mein Hab und Gut, hauptsächlich alte Möbel meiner Eltern, nach oben trugen, kam ein Mann hinter uns die Treppe hoch. Auf seiner Schulter prangte ein großer Kassettenrekorder, aus dem munter schrammelige Musik herauswummerte. Er brabbelte etwas. Dann waren nur noch Poltern und Krach zu hören. Der Mann, ein Hausbewohner wie sich herausstellte, war gestürzt und einige Stufen hinabgefallen. Ernsthafte Schäden hatte er wohl nicht davongetragen. Er verschwand ein Stockwerk unter meiner Wohnung fluchend in seiner Wohnung.
Mein Vater sah mich eindringlich an.
»Junge, hier bleibst du nicht. Du kommst wieder mit nach Hause!«
Ich blieb natürlich doch. Mein Vater fuhr noch in derselben Nacht zurück und ich war froh, dass er auf der Rückfahrt nicht eingeschlafen ist. Nun war ich allein in meiner ersten eigenen Wohnung inmitten von 1,5 Millionen anderen Menschen, die für mich eine undurchsichtige, graue Wand bildeten. Je grauer mir die Wand erschien, desto lieber tauchte ich auf den Meeresgrund hinab und ließ den vertrauten Schlick durch meine Finger gleiten.
Mit der Zeit lernte ich, dass meine türkischen Mitbewohner wesentlich freundlicher waren als die deutschen. Auf den besonderen Charme Berlins sollte ich bereits am ersten Morgen treffen. In der Bäckerei an der nächsten Ecke bestellte ich Brötchen, wie ich es schon so oft für meine Familie getan hatte.
»Ham wa nich!«, bekam ich von der Verkäuferin, einer Frau jenseits der Fünfzig, zurück.
Verdattert zeigte ich auf die Brötchen in der Auslage.
»Nee, nee, junger Mann, dit sint Schrippen!«
»Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!«, ist der Schlachtgesang der Fans im deutschen Fußballpokal. So oft hatte ich ihn im Fernsehen durch die Stadien hallen hören. Der Wassermann war nicht auf einer Studienreise oder einem kurzweiligen Besuch in der ummauerten Stadt, jetzt wohnte er hier.
Berlin erschien mir als Teil einer riesigen Neonwelt in kühlen Farben mit einem permanenten bläulichen Unterton, obwohl es August und die Stadt grün war. Im Wedding waren die meisten Häuser grau und unsaniert. Allein Graffitis brachten Farbe an die Hauswände. Nahezu alles war beschmiert. Überall Hundescheiße. Die Stadt wirkte auf mich kalt, nicht cool. Es gibt viele Parkanlagen, aber vor allem Bäume in den Straßen. Trotzdem konnte ich keine frische Brise einatmen. Um mich herum schien alles zu pulsieren. Ich versuchte, danach zu greifen, aber es gelang mir nicht, es zu erreichen. Menschen huschten wie Phantome an mir vorbei. Alles rieselte durch meine Finger hindurch. Ich konnte niemanden fassen. Die Berliner lächelten nicht, waren mit sich selbst beschäftigt und nahmen keine Notiz von mir. Die koddrige »Berliner Schnauze«, die zu allem und jedem seinen Senf dazugeben musste und ein paar lockere Sprüche drauf hatte, war mehr als gewöhnungsbedürftig. Sie erschien mir als Niedersachse und »Karl Korrekt« frech und unverschämt.
»Hatter denn den Fünfer nich’n bisken kleener?« beim Bäcker,
»Na, hammawa nu det richt’je Jesöff jewälht?« in der Eckkneipe,
»Da warn wa wohl’n bisken fix, wa?« beim Umbestellen oder
»Du glotzt ma an, hau ab, du machst mir noch krank!« auf der Straße ließen meine Ohren klingeln.
Manchmal verstand ich die Berliner auch einfach nicht. »JWD« war über die Grenzen Berlins bekannt, doch wussten Sie, dass es »Janz weit draußen« bedeutet und der Urberliner damit alles hinter der Stadtgrenze und nicht die Pampa in Südamerika meint?
Es gab für den hungrigen, abenteuerlustigen Wassermann so viel zu entdecken, zu erleben, zu tun, zu lieben. Und doch hatte ich noch keinen Zugang zu Berlin gefunden.
Nach ein paar Wochen wurde mein Leidensdruck zu groß. Aus Verzweiflung und Langeweile ging ich am Freitagabend in die Nachtvorstellung eines Kinos um die Ecke. Ich war zuvor noch nie allein im Kino gewesen. Es hatte mich Mut gekostet, mir einzugestehen, dass ich allein war, es auch nach außen für jeden erkennbar zu zeigen und eben nicht in einer Clique vermeintlich selbstsicher auftreten zu können. Das Kino lag in einem abrissreifen Haus und sah innen drin genauso renovierungsbedürftig aus. Es liefen keine aktuellen Popkornkinohits, sondern alte Streifen als Teil einer kulturellen Retrospektive. Ich entschied mich für Peter Sellers in »Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben.« Sellers spielte darin gleich drei Rollen. Es ging um einen Atomkrieg und eine Weltvernichtungsmaschine zurzeit des Kalten Krieges. Ich kannte den Film schon und schlief nach zwei Büchsen Bier ein. Die Büchsen hatte ich aus Kostengründen reingeschmuggelt. Beim Abspann und mit fadem Biergeschmack im Mund wachte ich im fast leeren, riesigen Kinosaal 1 auf. Was sollte ich nun mit mir anfangen? Nach Hause gehen, hätte mich weiter in den Schlund der Einsamkeit fallen lassen. Im Foyer kaufte ich mir dann doch noch ein Bier, um mir Mut anzutrinken.
Während unserer Studienreise einige Jahre zuvor hatten Schulkameraden und ich uns nachts davon gestohlen und waren in der Diskothek »Linientreu« gelandet. Kurz entschlossen machte ich sie nun zu meinem Ziel. Nervös betrat ich die U-Bahnstation Seestraße und studierte die Liniennetzkarte, was eine Wissenschaft für sich ist. Ich musste nur einmal am Leopoldplatz mit Ziel Zoologischer Garten umsteigen. Es erschien mir wie eine Weltreise. Nachdem ich einen Fahrschein gelöst hatte, eine weitere Wissenschaft, saß ich mit meiner Bierbüchse in der U-Bahn eingeschüchtert zwischen einer Menge lauter, aufgeregter und besoffener Nachtmenschen. Ich versuchte, niemanden zu sehr anzustarren, um keinen Ärger zu bekommen. Den Weg vom Zoo zum Linientreu kannte ich noch. Vom Breitscheidplatz immer gerade aus.
Die Disco war in Waver-Kreisen weit über die Grenzen Berlins bekannt. Das Linientreu, der vollständige Name lautete Tanz-Arena Linientreu, lag im Keller des Bikinihauses in der Budapester Straße gegenüber dem Europa-Center und der Gedächtniskirche. Berühmt war die große, runde, mit silbernen Metallplatten belegte Tanzfläche im Hauptraum, die von zwei bis drei Sitzreihen wie in einem Amphitheater umsäumt wurde. Auch das ausschließlich in Schwarz, Weiß oder Silber gehaltene Inventar kannte man. Das Linientreu war zu dieser Zeit eine der angesagtesten Discos der Stadt mit einer musikalischen Mischung aus New Wave, Dark Wave, Electro Wave, Punk und Rockabilly. Sobald früh morgens die Lichter angingen, stoben die Kreaturen der Nacht auseinander, als hätten sie wie Vampire Angst vor dem Tageslicht.
Ich stelle mich an der Schlange an, wartete, zahlte fünf Mark Eintritt und stand ganz allein mitten im Leben.
Diskotheken an sich waren mir nicht fremd, kein unbekanntes Terrain für mich. Doch war ich noch nie allein ausgegangen. In meiner Heimat konnte ich mir immer sicher sein, jemanden zu treffen, wenn ich unverabredet tanzen ging. An der Bar bestellte ich ein Beck’s Bier und zahlte drei Mark. Tanzen traute ich mich nicht. So stand ich an eine der großen Boxen gelehnt im Durchgang zur Tanzfläche und betrachte die Gäste. Mein Blick blieb bei einer Frau hängen, die auf der anderen Seite im Durchgang stand. Sie hatte unendlich lange, schlanke Beine, die in einem knappen rot karierten Schottenrock endeten. Ich konnte mich nicht erinnern, jemals so faszinierende Beine gesehen zu haben. Eine durch und durch attraktive Frau mit langen rot-blonden Haaren und süßen Sommersprossen. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, beobachtete ich sie den Abend über. Sie schien einige Leute zu kennen, aber nicht in männlicher Begleitung zu sein. Ihre Bewegungen auf der Tanzfläche waren spartanisch elegant. Ich wusste nicht, was ich tun sollte? Ich hatte schon länger keinen engeren Kontakt mehr zu Frauen gehabt. Nach langer Zeit des Haderns und Zauderns und stundenlangen inneren Kampfes durchquerte ich endlich den Raum und sprach die Frau an. Mein Kopf hatte mir immer wieder gesagt, dass diese Frau mich nur abblitzen lassen konnte, und ich wie ein Idiot am ersten Ausgehabend in Berlin da stehen würde.
»Ich habe noch nie so schöne Beine gesehen!«, fiel ich mit der Tür direkt ins Haus. Wer kennt schon einen originellen Anmachspruch?
»Du hast etwas verloren, ich gebe es dir zurück!«, wobei ein Zettel mit der eigenen Telefonnummer übergeben wird.
»Und ich dachte, ich sei schön!«
»Du hast wunderschöne Lippen. Kann man die küssen?«
»Du musst der Grund für die globale Erderwärmung sein!«
»Bist du eine Außerirdische? Du kannst nicht von diesem Planeten sein!«
»Bist du ein Dieb? Du hast mein Herz gestohlen!«
Gott sei Dank ließ mich die Traumfrau nicht abblitzen und zerstört nach Hause kriechen. Nicole unterhielt sich nett mit mir, und ich durfte auch einmal mit ihr tanzen. Ich wünschte, dass dieser Abend nie enden möge. Endlich stand ich mal mit einem Fuß in der Tür Berlins. Als die Lichter gegen 06.30 Uhr angingen, fragte mich Nicole, ob ich noch zusammen mit ihr und einem Bekannten im Schwarzen Café frühstücken gehen wollte. Und ob ich wollte. Mir war es egal, ob es sich bei diesem Bekannten um eine »Anstandsdame« handelte oder nicht. Ich war überaus glücklich. Das Schwarze Café lag fußläufig erreichbar in der Kantstraße und war ein Mekka für Nachtschwärmer, da es 24 Stunden geöffnet und faire Preise hatte. Der Name rührte von schwarz gestrichenen Wänden ab. Hier saß ich also nun mit Nicole und Marius. Es war eine überaus nette Plauderei. Gegen 09:00 Uhr trennten wir uns. Nicole hatte mir ihre Telefonnummer gegeben. Den Zettel steckte ich vorsichtig wie einen Schatz in meine Hosentasche. Marius hatte denselben Heimweg wie ich. Wunderbarerweise wohnte er nur zwei Straßenzüge von mir entfernt ebenfalls im Afrikanischen Viertel. Marius war ein Jahr älter als ich und gehörte zu den New Romantikern. Die hießen bei uns in Hannover New Waver. Wir unterhielten uns auf der Rückfahrt über Musik und stellten geschmackliche Übereinstimmungen fest. Er kannte sich aber viel besser aus. Auch Marius gab mir bei unserer Verabschiedung auf dem U-Bahnhof Seestraße seine Telefonnummer.
Übermüdet und gleichzeitig aufgekratzt ging ich mit meiner Beute, zwei Telefonnummern, an den Tretminen vorbei nach Hause.